Grüne Lösung oder Weltraumschrott 2.0? Die Realität orbitaler Rechenzentren
Gerade lesen andere
Grüne Lösung oder Weltraumschrott 2.0? Die Realität orbitaler Rechenzentren
Wenn die Cloud den Planeten verlässt

Künstliche Intelligenz, Streaming und unser ständig vernetztes Leben treiben eine wahre Explosion digitaler Daten an.
Hinter jedem Klick verbirgt sich eine physische Realität: riesige Rechenzentren, die Strom verschlingen, Landflächen beanspruchen und Kohlendioxid in die Atmosphäre pumpen.
Da dieser Bedarf weiter wächst, stellen einige Unternehmen nun eine radikale Frage: Wenn die Erde an Platz und sauberer Energie knapp wird – warum nicht einen Teil der Cloud ins All verlagern? Der Orbit, so das Argument, bietet unbegrenzte Sonnenenergie und benötigt keine Flächen auf der Erde – doch er bringt auch ein völlig neues Risikospektrum mit sich.
Der Weltraum als nächste Datenfrontier

Wie CNN berichtet, prognostiziert Goldman Sachs, dass der Energiebedarf von Rechenzentren bis 2030 um etwa 165 % steigen wird.
Lesen Sie auch
Rechenzentren verbrauchen bereits heute enorme Energiemengen und benötigen große Flächen für Gebäude sowie für nahegelegene Solar- oder Windparks. In Europa hat das von Thales Alenia Space geleitete ASCEND-Projekt untersucht, ob weltraumgestützte Rechenzentren, die kontinuierlich durch Sonnenenergie betrieben werden, die CO₂-Emissionen gegenüber erdgebundenen Anlagen senken könnten.
Die Studie kam zu dem Schluss, dass der Orbit theoretisch eine „umweltfreundlichere und souveräne Lösung“ für Datenspeicherung und -verarbeitung bieten könnte – allerdings nur, wenn bedeutende technologische Fortschritte, insbesondere deutlich sauberere Raketen, Realität werden.
Erste Experimente mit orbitalem Computing

Wie CNN weiter berichtet, erproben bereits mehrere Unternehmen das Konzept im kleinen Maßstab. Madari Space aus Abu Dhabi plant seine erste Mission für 2026: eine Nutzlast in Toastergröße mit Speicher- und Rechenhardware, die im Rahmen einer UNO-Initiative „Access to Space for All“ in den Orbit gebracht werden soll.
Madaris CEO Shareef Al Romaithi argumentiert, dass die Datenverarbeitung direkt im All – insbesondere für Erdbeobachtungssatelliten – Verzögerungen verringern und schnellere Entscheidungen ermöglichen könnte.
Unterdessen hat China die ersten 12 Satelliten einer geplanten 2.800-Satelliten-Konstellation für Weltraumcomputing gestartet, und US-Unternehmen ziehen nach.
Lesen Sie auch
Lonestar Data Holdings hat ein winziges Rechenzentrum auf dem Mond getestet und plant eine Serie von Speichersatelliten am Erde-Mond-L1-Punkt, während Starcloud den Start eines Satelliten mit einer leistungsstarken Nvidia H100-GPU vorbereitet, der nach eigenen Angaben einen Rekord an Rechenleistung im Orbit aufstellen soll. Einige Befürworter, darunter Starcloud-CEO Philip Johnston, prognostizieren sogar, dass „in zehn Jahren fast alle neuen Rechenzentren im Weltraum gebaut werden könnten“.
Klimaschutz oder orbitaler Albtraum?

Laut CNN gibt es erhebliche Zweifel daran, ob Weltraum-Rechenzentren tatsächlich praktikabel oder klimafreundlich sind. Die ASCEND-Studie schätzte, dass Trägerraketen zehnmal weniger CO₂ über ihren Lebenszyklus ausstoßen müssten als heutige Modelle, um tatsächlich Emissionen gegenüber irdischen Rechenzentren einzusparen.
Kritiker wie Quentin A. Parker von der University of Hong Kong argumentieren, dass unter Berücksichtigung von Startkosten, Strahlungsschutz, Kühlung im Vakuum, Wartung sowie dem Schutz vor Weltraumschrott und Weltraumwetter erdgebundene Lösungen nach wie vor deutlich günstiger und einfacher seien.
Parker warnt zudem, dass der Start Tausender zusätzlicher Datensatelliten die bestehende Weltraumschrottkrise verschärfen und neue Schwachstellen schaffen könnte – selbst wenn Befürworter behaupten, die Technologie könne die Resilienz gegen Naturkatastrophen und Cyberangriffe auf der Erde verbessern.
Unterstützer wie Al Romaithi entgegnen, dass der Blick über die Erde hinaus notwendig sei, um „technologische Stagnation“ zu vermeiden – doch das Gleichgewicht zwischen Nutzen und Risiko bleibt höchst umstritten.
Lesen Sie auch
Was wir gelernt haben

Weltraum-Rechenzentren stehen an der Schnittstelle von Klima, Technologie und orbitaler Sicherheit. Einerseits machen kontinuierliche Sonnenenergie und die Entlastung von Flächen- und Netzengpässen den Orbit zu einer verlockenden Vision.
Andererseits werfen Raketenemissionen, extreme Kosten, Strahlung, Trümmer und Wartungsprobleme ernste Zweifel auf, ob es sich tatsächlich um eine Klimaschutzmaßnahme oder eher um eine futuristische Ablenkung handelt.
Die Debatte zwingt uns, eine unbequeme Wahrheit anzuerkennen: Unser Hunger nach Daten hat planetarische Folgen – egal, wo wir die Server platzieren.
Der Preis einer unendlichen Cloud
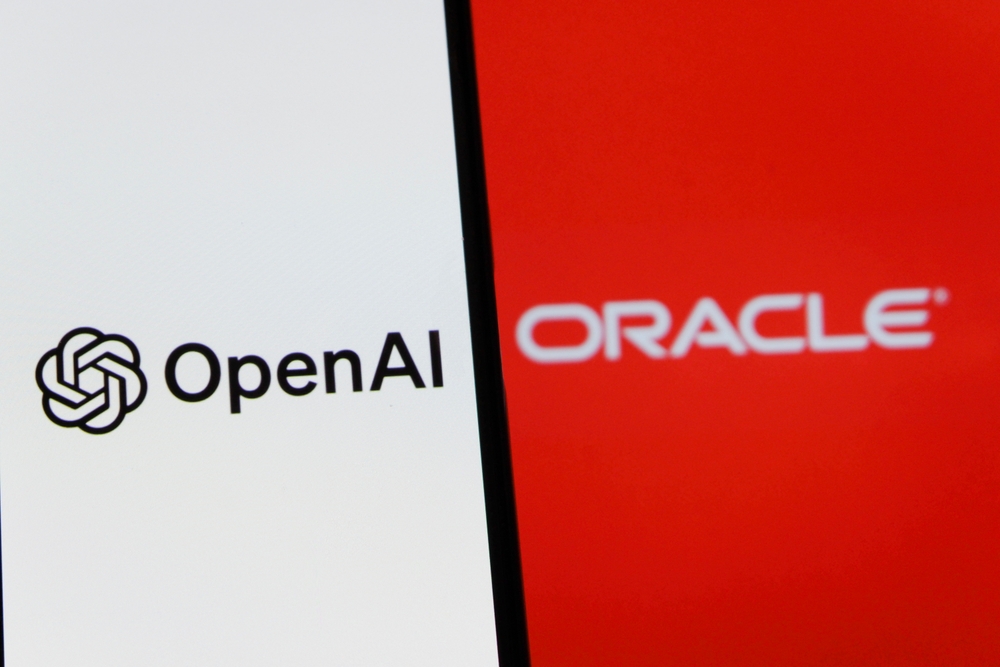
Die Vorstellung, die Cloud ins All zu schicken, klingt nach Science-Fiction – doch die Kräfte, die sie antreiben, sind real.
Mit dem Wachstum von KI und digitalen Diensten stehen wir vor einer Wahl: Entweder wir machen unsere Datenverarbeitung auf der Erde radikal effizienter und nachhaltiger, oder wir verlagern die Infrastruktur in empfindliche, schwer kontrollierbare Umlaufbahnen, die schon jetzt überlastet sind.
Lesen Sie auch
Am Ende könnte der Bau von Rechenzentren im All weniger eine grüne Revolution als eine teure Illusion sein – eine, die uns daran erinnert, dass jede digitale Innovation auch ihre eigene ökologische Spur hinterlässt.

